 „Ó paí, ó“ – so heißt ein brasilianischer Spielfilm über den touristischen Stadtteil Pelourinho („Schandpfahl“) und seine Bewohner in Salvador da Bahia; zu erstehen u. a. als Raubkopie für fünf Real bei den Straßenhändlern vor dem Lapa Shopping Center, unweit des Praça Piedade im Zentrum Salvadors. Ein Streifen, der anders als die mit Preisen ausgezeichneten Filme „Tropa de Elite“ oder „Cidade de Deus“ eher weniger auf spektakuläre Szenen von Bandenkriminalität setzt, sondern humorvoll den Alltag in diesem Viertel und dieser Stadt skizziert:
„Ó paí, ó“ – so heißt ein brasilianischer Spielfilm über den touristischen Stadtteil Pelourinho („Schandpfahl“) und seine Bewohner in Salvador da Bahia; zu erstehen u. a. als Raubkopie für fünf Real bei den Straßenhändlern vor dem Lapa Shopping Center, unweit des Praça Piedade im Zentrum Salvadors. Ein Streifen, der anders als die mit Preisen ausgezeichneten Filme „Tropa de Elite“ oder „Cidade de Deus“ eher weniger auf spektakuläre Szenen von Bandenkriminalität setzt, sondern humorvoll den Alltag in diesem Viertel und dieser Stadt skizziert:
Trotz Minimo Salárío (Mindestverdienst, etwa 400 Real monatlich inklusive freier Kost und Logis) mogelt man sich erfolgreich durch den Alltag, sucht seinen persönlichen Jeitinho (Trick des Überlebens), lebt für den Augenblick und den nächsten Karneval – es wird auf den Straßen zugleich gestorben und geliebt und getanzt. Es ist die Energie der Menschen, die niemanden kalt bleiben lässt. Jorge Amado, Salvadors berühmtester Schriftsteller, bemerkte dazu einmal: „Das Volk ist stärker als die Armut. Auch wenn das Überleben vor lauter Schwierigkeiten und Grausamkeiten fast unmöglich erscheint, das Volk lebt, kämpft, lacht, gibt nicht auf.“
Man tut gut daran, hinter die Kulissen zu schauen, denn aufgrund der günstigen Flugverbindungen nach Salvador da Bahia boomt die Stadt als neues Tor zu Brasilien. Und die europäischen Touristen gelangen alle früher oder später in den Stadtteil Pelourinho, sind hier doch die bedeutendsten Kolonialbauten, Museen, Kirchen und eine komplette historische Barockstadt aus der Portugiesenzeit zu besichtigen.
Man kann tapsige Reisegruppen aus Spanien, Portugal, Argentinien, Holland oder Deutschland beobachten, die mit eigenem Sheriff und Reiseleiter über das Kopfsteinpflaster der Gassen geschleust werden, unangenehm berührt von zahnlosen Bettlern mit aufgeblähten Bäuchen (fast immer ein Zeichen von Wurmbefall und auf verunreinigtes Trinkwasser zurückzuführen) und aufdringlichen Schmuckverkäufern, die bunte Candomblé-Bändchen als gratis Presente anbieten und doch nur ihre überteuerten Holzketten verkaufen wollen. Auch in Brasilien wird ein Geschenk gewöhnlich mit einem Gegengeschenk beantwortet. Capoeira-Tänzer und Frauen in traditionellen Kostümen posieren für zehn Real vor den ausländischen Digitalkameras und Camcordern, oftmals routiniert wie Heidi Klum. Später verweilt man in einem dieser romantischen Cafés in der Altstadt, sitzt auf Plastikhockern, die schief auf dem Kopfsteinpflaster aufliegen und lauscht versonnen den brasilianischen Liedermachern mit ihrer Akustikgitarre.  Die Kellner in den blütenweißen Hemden servieren den Touristen aus Übersee überteuertes Bier für fast 8 Real (inklusive Zuschlag für die Musiker und Service) und ernten dafür ein schüchternes „Obrigado“. Die Romantik bröckelt dann doch irgendwann. Zu späterer Stunde wechseln nämlich Ware und Gäste, es erscheinen die Mariposa de la Noite, die Garotas de Programa, die auf Gringofang gehen und sich hier vor der Nachtschicht für fünf bis zehn Real die Nase pudern – Kokain kostet in Brasilien nur einen Bruchteil des europäischen Marktpreises. Man kennt sich, Kellner und Mädchen zwinkern einander zu, es gibt wenig neue Gesichter in der vertrauten Szene und die Toilette ist oft besetzt.
Die Kellner in den blütenweißen Hemden servieren den Touristen aus Übersee überteuertes Bier für fast 8 Real (inklusive Zuschlag für die Musiker und Service) und ernten dafür ein schüchternes „Obrigado“. Die Romantik bröckelt dann doch irgendwann. Zu späterer Stunde wechseln nämlich Ware und Gäste, es erscheinen die Mariposa de la Noite, die Garotas de Programa, die auf Gringofang gehen und sich hier vor der Nachtschicht für fünf bis zehn Real die Nase pudern – Kokain kostet in Brasilien nur einen Bruchteil des europäischen Marktpreises. Man kennt sich, Kellner und Mädchen zwinkern einander zu, es gibt wenig neue Gesichter in der vertrauten Szene und die Toilette ist oft besetzt.
In der schmuddeligen Gasse hinter den Touristenrestaurants wanken betäubte Gestalten durch die junge Nacht. Die unverwüstlichen Klassiker von Bob Marley, neben Nelson Mandela und Malcom X einer der Helden des schwarzen Salvadors, wehen über das raue Kopfsteinpflaster. Musicá de Malandros – Gangstarap für die einen, Befreiungsmusik für die anderen. Am Morgen erscheint hier regelmäßig ein Trupp städtischer Angestellter mit einem Hochdruckreiniger und kärchert die Reste der vergangenen Nacht in das Universum.
Nebenan beklagt ein Münchner Kneipenwirt, seit 13 Jahren im Pelourinho beheimatet, dass seine Gäste selbst Glühbirnen und Klopapier vom Lokus klauen würden. Ab sofort, so sein Plan, wird die Toilette so eng zugemauert, dass sich nur noch eine Person hereinzwängen kann. Warum? Nun ja, auf diese Weise gäbe es keine ausschweifenden Sex- und Drogenpartys mehr auf der Klobrille, also weniger Diebstähle und keine lästigen Polizeikontrollen, die mit aufgehaltener Hand nach „Bakschisch“ verlangen. Denn als Gringo, das ist klar, zahlt man hier immer für andere mit – Brasilien eben.
 An den strategischen Punkten wacht durchaus das Auge des Gesetzes über den europäischen Touristenstrom, oftmals mit blinkenden Digitalkameras und kostbaren Uhren behangen. Aber auf diese unmotivierte Truppe ist nicht wirklich Verlass, zu gering ist das Einkommen (etwa 800 bis 1.000 Real monatlich), zu verbreitet die Korruption, zu groß das Desinteresse, einem beklauten Touristen beizustehen: Wer sich ein Flugticket nach Brasilien leisten kann, der kann sich auch eine neue Kamera kaufen.
An den strategischen Punkten wacht durchaus das Auge des Gesetzes über den europäischen Touristenstrom, oftmals mit blinkenden Digitalkameras und kostbaren Uhren behangen. Aber auf diese unmotivierte Truppe ist nicht wirklich Verlass, zu gering ist das Einkommen (etwa 800 bis 1.000 Real monatlich), zu verbreitet die Korruption, zu groß das Desinteresse, einem beklauten Touristen beizustehen: Wer sich ein Flugticket nach Brasilien leisten kann, der kann sich auch eine neue Kamera kaufen.
Ein weiteres Problem ist die schwerfällige Justiz Brasiliens – nur rund 10% aller Gewalttäter werden rechtskräftig verurteilt. Also stehen die Uniformierten – wenn sie nicht gerade wieder streiken oder dunkelhäutige Verdächtige verhaften – sonntags grinsend in ihrer Wache und amüsieren sich über die Schlangen von herausgeputzten Touristen, die für ein Konzert der Sambagruppe Olodum neben der Casa de Journalista anstehen. Der Eintrittspreis beträgt dreißig Real und wird ohne mit der Wimper zu zucken gezahlt. Eine Summe, für die sich die Mädchen in der schmuddeligen Cidade Baixa (Unterstadt) bereits verkaufen oder gut gelaunte Drogenhändler bis zu fünf Gramm Kokain verhökern. Daneben die zerlumpten Dosensammler, die das zerdrückte Leergut der Touristen einsammeln und in riesigen Plastiksäcken hinter sich herziehen (manchmal auch mit Diebesgut gefüllt), und die für dreißig Real wohl bald eine Woche lang arbeiten müssten. Und auch der strubbelige Straßenjunge ist wieder da, der immer mit den drei Kokosnüssen vor den Touristen jongliert und auf diese Weise hin und wieder ein durchaus attraktives Einkommen erzielt. Sein Freund ist ein einäugiger Straßenhändler, ein Cachaçeiro (Säufer) mit schmierigem Handkarren, der einzelne Zigaretten, Streichhölzer und Bonbons für wenige Centavos anbietet. Eine Welt, in der die großen Fische die kleinen auffressen.
Und so ist es hier im Pelourinho der auffällige Kontrast zwischen arm und reich, der sich immer wieder unerfreulich bemerkbar macht. Normale Baianos lassen sich hier denn auch so selten wie möglich blicken, gilt der Stadtteil doch als touristisches „Disneyland“, in dem alles völlig überteuert ist und sich nächtens nur verdorbene Mitmenschen herumdrücken.
Copyright Text & Fotos: Ralf Falbe / cybertours-x Verlag

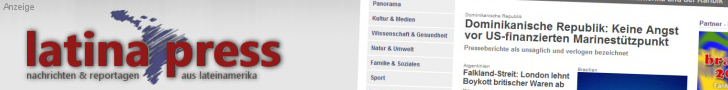

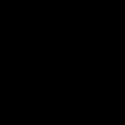
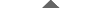































 © 2005 – 2024 Das brasilien Magazin ist ein Angebot von
© 2005 – 2024 Das brasilien Magazin ist ein Angebot von